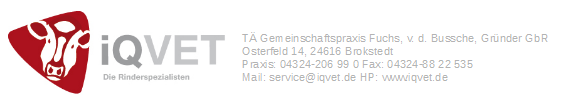RindertierärztINNEN BLOG
29.4.15
9.2.15
TierärztIN in Teilzeit in Teltow-Felming gesucht
Tierarzt (m/w) gesucht
Stellenausschreibung im Veterinäramt, Teilzeit - Bewerbung bis 27. Februar 2015
Datum: 05.02.2015
Der Landkreis Teltow-Fläming schreibt extern die Stelle
Tierarzt/-ärztin Veterinärwesen (Teilzeit: 20 Wochenarbeitsstunden)
zur sofortigen Besetzung und befristet zur Vertretung aus. Die Behörde hat ihren Sitz am Standort Luckenwalde. Die Tätigkeit ist mit Außendienst verbunden.
Tierarzt/-ärztin Veterinärwesen (Teilzeit: 20 Wochenarbeitsstunden)
zur sofortigen Besetzung und befristet zur Vertretung aus. Die Behörde hat ihren Sitz am Standort Luckenwalde. Die Tätigkeit ist mit Außendienst verbunden.
Aufgaben
- Tierschutzkontrollen einschließlich Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Verstößen gegen das Tierschutzrecht
- Kontrollen im Bereich Tierseuchenprophylaxe und –bekämpfung, Ausstellen von Gesundheitsbescheinigungen für den Export oder das Verbringen lebender Tiere
- Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften auf den Gebieten des Tierkörperbeseitigungs- und Tierarzneimittelrechts
- ordnungsbehördliche Aufgaben
Anforderungen
- approbierter Tierarzt/apporbierte Tierärztin
- Berufserfahrung erwünscht
- Durchsetzungsvermögen/Überzeugungskraft
- Teamfähigkeit
- PC-Kenntnisse
- PKW-Führerschein
- Einsatz zu flexiblen Arbeitszeiten
Vergütung
Entgeltgruppe 13 TVÖD, VKA (Vergr. II, 3/I b, 12 ÄrzteTV, BAT-O-VKA)Bewerbung
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind besonders erwünscht und werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitten wir Sie, einen adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag beizufügen.
Ihre aussagefähige Bewerbung, inklusive einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse senden Sie bitte bis zum 27. Februar 2015 an den
Landkreis Teltow-Fläming
Büro der Landrätin
SG Personal und Organisation
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
E-Mail: personal@teltow-flaeming.de
RindertierärztIN für tolles Team gesucht!
Wir arbeiten in einem smarten Praxisteam von 6 Tierärzten und 3 Fachangestellten
mitten in Schleswig-Holstein. Wir sind ausschließlich auf Rinder ausgerichtet,
wobei 95 % unserer Geschäftspartner Milchviehbetriebe sind.
Unser Praxisalltag ist
klar strukturiert.
Unsere Organisation beruht auf
regelmäßiger integrierter Bestandsbetreuung mit festen
Besuchsterminen, Besuchserinnerungssystem und festen Arbeitszeiten im 2-Schicht-System.
Daraus folgt auch eine ziemlich verlässliche Freizeitregelung und die Nähe zur
Landeshauptstadt Kiel und zur Metropole Hamburg macht den Standort der Praxis für private
Aktivitäten attraktiv. Alle Mitarbeiter sind junge Leute und es findet, auch außerhalb der festen
meeting-Termine, ein reger fachlicher und persönlicher Austausch statt.
Wir hoffen mit diesem kurzen Statement Ihr Interesse geweckt zu haben und würden
uns freuen, wenn Sie zu einem persönlichen Gespräch bereit wären.
Besuchsterminen, Besuchserinnerungssystem und festen Arbeitszeiten im 2-Schicht-System.
Daraus folgt auch eine ziemlich verlässliche Freizeitregelung und die Nähe zur
Landeshauptstadt Kiel und zur Metropole Hamburg macht den Standort der Praxis für private
Aktivitäten attraktiv. Alle Mitarbeiter sind junge Leute und es findet, auch außerhalb der festen
meeting-Termine, ein reger fachlicher und persönlicher Austausch statt.
Wir hoffen mit diesem kurzen Statement Ihr Interesse geweckt zu haben und würden
uns freuen, wenn Sie zu einem persönlichen Gespräch bereit wären.
Ihre Kontaktperson ist Daniel
Fuchs: fuchs@iqvet.dec
Viele Grüße aus Holstein
23.1.15
Kostenloses E book Fütterung der MIlchkuh
Hohe Anforderungen bei der Milchkuhhaltung
Die Haltung von Milchkühen stellt besonders hohe Anforderungen an Landwirte, denn das Futter für die anspruchsvollen Tiere muss aus bestimmten Nährstoffen und anderen Komponenten zusammengesetzt sein, um eine hohe und qualitativ einwandfreie Milchproduktion zu erzielen. Des Weiteren müssen die Milchbauern bei ihrer Kalkulation die steigenden Futterkosten und die sinkenden Milchpreise berücksichtigen. Auch der Umweltschutz und das Wohlbefinden der Kühe spielen eine wichtige Rolle, denn nur stressfreie, gesunde Tiere können ihr Produktionsmaximum erzielen.
Fütterung junger Kühe
Um eine hohe Menge an Milch von optimaler Qualität zu erhalten, müssen Kühe von klein auf richtig gefüttert werden. Bereits direkt nach der Geburt benötigen Kälber eine Versorgung mit hochwertigem Futter. Sie sind besonders anfällig für Krankheiten, da sie noch kein eigenes Immunsystem besitzen. In modernen Milchbetrieben erhalten sie Immunglobuline zur Stärkung der Abwehrkräfte nicht über die Milch der Mutterkühe, sondern als Futterzusatz, um eine Infektion mit Keimen zu vermeiden. Später werden die Jungtiere mit Rauhfutter versorgt. Dieses stärkt besonders den Pansen, der für eine optimale Nährstoffaufnahme unverzichtbar ist.
Die Bedeutung der Milchquote
Mehr dazu im E-Book Fütterung Milchkuh
Da Milch als Lebensmittel von hoher Bedeutung ist, unterliegen ihre Herstellung und ihr Preis nicht den Gesetzen des freien Marktes, sondern sie werden vom Staat gesetzlich geregelt. So gibt der Staat z. B. für jeden Betrieb die Milchquote vor, durch welche die zu erzeugende Höchstmenge an Rohmilch geregelt wird, um eine Überproduktion zu vermeiden. Dreimal im Jahr findet die Milchquotenbörse statt, die dem Staat als Instrument zur Kontrolle von Milchpreis und Milchmarkt dient. Auf dieser Börse findet der An- und Verkauf der Milchkontigente statt.
Text: Markus Fuchs
Die Haltung von Milchkühen stellt besonders hohe Anforderungen an Landwirte, denn das Futter für die anspruchsvollen Tiere muss aus bestimmten Nährstoffen und anderen Komponenten zusammengesetzt sein, um eine hohe und qualitativ einwandfreie Milchproduktion zu erzielen. Des Weiteren müssen die Milchbauern bei ihrer Kalkulation die steigenden Futterkosten und die sinkenden Milchpreise berücksichtigen. Auch der Umweltschutz und das Wohlbefinden der Kühe spielen eine wichtige Rolle, denn nur stressfreie, gesunde Tiere können ihr Produktionsmaximum erzielen.
Fütterung junger Kühe
Um eine hohe Menge an Milch von optimaler Qualität zu erhalten, müssen Kühe von klein auf richtig gefüttert werden. Bereits direkt nach der Geburt benötigen Kälber eine Versorgung mit hochwertigem Futter. Sie sind besonders anfällig für Krankheiten, da sie noch kein eigenes Immunsystem besitzen. In modernen Milchbetrieben erhalten sie Immunglobuline zur Stärkung der Abwehrkräfte nicht über die Milch der Mutterkühe, sondern als Futterzusatz, um eine Infektion mit Keimen zu vermeiden. Später werden die Jungtiere mit Rauhfutter versorgt. Dieses stärkt besonders den Pansen, der für eine optimale Nährstoffaufnahme unverzichtbar ist.
Die Bedeutung der Milchquote
Mehr dazu im E-Book Fütterung Milchkuh
Da Milch als Lebensmittel von hoher Bedeutung ist, unterliegen ihre Herstellung und ihr Preis nicht den Gesetzen des freien Marktes, sondern sie werden vom Staat gesetzlich geregelt. So gibt der Staat z. B. für jeden Betrieb die Milchquote vor, durch welche die zu erzeugende Höchstmenge an Rohmilch geregelt wird, um eine Überproduktion zu vermeiden. Dreimal im Jahr findet die Milchquotenbörse statt, die dem Staat als Instrument zur Kontrolle von Milchpreis und Milchmarkt dient. Auf dieser Börse findet der An- und Verkauf der Milchkontigente statt.
Text: Markus Fuchs
12.12.14
Tiermedizin ist weiblich
Tiermedizin ist weiblich – eine neue Initiative für Zukunftsperspektiven in der Tiermedizin
von Dr. Christina Lauer
Als sich im November 2013 rund 80 (angehende) Tierärztinnen (und
Tierärzte!) in Berlin zur Veranstaltung von „Rin.da! – Frauen in die
Rindermedizin“ zusammenfanden, ahnte wohl noch niemand, dass wir damit offenbar
eine Bewegung für eine Generation an Tierärzten ins Leben riefen, der es ein
großes Bedürfnis ist, über ihre Zukunft zu reden – und über die Missstände,
denen sie tagtäglich begegnet. Die Rede ist von der „neuen“ Generation, der
„Generation Y“, den in den 90er-Jahren Geborenen, die nun auf den
tiermedizinischen Arbeitsmarkt strömen. Diese Generation ist anders als die
bisherige - und stößt damit auf viel Unverständnis vonseiten der älteren
(Chef)Generationen. Warum eigentlich?
Die Generation Y ist in aller Munde
Nicht nur die Tierärzte stehen fassungslos vor einer
Generation, die offensichtlich ganz andere Werte vertritt als die bisherigen
Generationen der Babyboomer oder Generation X: Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Work-Life-Balance – kurz: Sie arbeitet, um zu leben. Dass dies im
absoluten Widerspruch zur Einstellung bisheriger Tierärztegenerationen steht,
wird mehr als deutlich, waren doch die Arbeitsalltage eher geprägt von der
Philosophie „Leben, um zu arbeiten“. Hinzu kommt – als Besonderheit in der Tiermedizin
–, dass mittlerweile nahezu 90 % der Studienanfänger weiblich sind. Es ist also
nicht übertrieben zu sagen, dass die Tiermedizin in Zukunft weiblich ist.
Von der Kluft zwischen Wunsch und Realität
Und genau da liegt der Knackpunkt oder vielmehr die
Diskrepanz: Während die junge Generation der Tierärztinnen für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine ausgeglichene Work-Life-Balance
steht, sieht die Realität ganz anders aus. Unlängst beschrieb eine anonyme
Autorin im Magazin VETimpulse ihren Klinikalltag, der geprägt ist von langen
Arbeitszeiten mit physischer Anwesenheitspflicht – und zu guter Letzt auch noch
von einem Gehalt, das ein (vom Einkommen des Partners oder gar der Eltern) unabhängiges
Leben kaum ermöglicht. Die Folge: Immer mehr Tierärztinnen entscheiden sich früher
oder später gegen die Praxis und für das Amt, die Industrie – oder gar eine
berufsfremde Tätigkeit. Und immer mehr Kliniken und Praxen haben Probleme,
qualifizierte Tierärzte zu finden.
Tiermedizin ist weiblich will etwas bewegen
Doch was soll da eine Initiative wie „Tiermedizin ist
weiblich“ bewegen? Derzeit geht es erst einmal darum, eine Plattform zu bieten,
die mögliche Zukunftsperspektiven für die tierärztliche Praxis aufzeigt. Dabei
geht es beispielsweise um Teilzeitkonzepte. Gleichzeitig soll sie als
Dialogplattform die Möglichkeit des – gern auch kontroversen – Austauschs
bieten. Und Aufklärung leisten über Missstände. Was daraus irgendwann einmal
entsteht, ist derzeit nicht vorherzusehen. Es ist in jedem Fall ein erster
Schritt - für ein besseres Generationenverständnis.
www.tiermedizin-ist-weiblich.de
Die Plattform ist unter dem Link
www.tiermedizin-ist-weiblich.de zu finden. Dort können Sie sich auch bequem für
den E-Mail-Newsletter eintragen, um keine Beiträge mehr zu verpassen. Gleichzeitig
findet eine Vernetzung über das soziale Netzwerk Facebook statt (www.facebook.com/tiermedizinistweiblich). In
regelmäßigen Abständen veranstaltet die Initiative Rin.da! Vortragsreihen rund
um das Thema „Frauen in der Rindermedizin“.
Ansprechpartner
Plattform „Tiermedizin ist weiblich“:
Dr. Christina Lauer (www.praxismarketing-lauer.de;
mail@praxismarketing-lauer.de)
Initiative Rin.da! – Frauen in die Rindermedizin:
Dr. Marion Tischer (www.vet-consult.de) und Prof. Kerstin
Müller (FU Berlin, Klinik für Klauentiere)
21.11.14
Stellenausschreibung (+Promotion)
Stellenausschreibung (+Promotion) zum Thema „Leberstoffwechsel bei Hochleistungskühen“
An der Lehr‐ und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Hofgut Neumühle ist zum 01. Dezember 2014 eine Dissertation für eine Veterinärmedizinerin oder einen Veterinärmediziner in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen, Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie (Prof. Dr. Klaus Eder) zu vergeben.
Die Eckdaten
- Spannendes und hochaktuelles Thema zur Stoffwechselgesundheit (Leberstoffwechsel) bei der hochleistenden Milchkuh.
- Sie erheben selbstständig alle Daten im Milchviehstall der Lehr‐ und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Hofgut Neumühle in 67728 Münchweiler an der Alsenz.
- Sie sammeln praktische Erfahrungen in der Milchproduktion am Hofgut Neumühle.
- Sie erhalten eine finanzierte Stelle über 3 Jahre (E 13/0,5).
- Sie arbeiten am Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie in einem international anerkannten wissenschaftlichen Team.
Unsere Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin
-Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift Spaß an der praktischen Milchviehproduktion
- Spaß am Umgang mit jungen Menschen
- Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem Team mit Doktorandinnen und Doktoranden
- Teamfähigkeit
- Überdurchschnittliche Motivation und Einsatzbereitschaft
- Kurzfristige Verfügbarkeit
- PKW‐Führerschein
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an folgende Adresse:
Dr. Christian Koch Lehr‐ und Versuchsanstalt für Viehhaltung,
Hofgut Neumühle Neumühle 1
67728 Münchweiler an der Alsenz
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Dr. Christian Koch zur Verfügung.
(Tel.: 06302/60343 oder e‐mail: c.koch@neumuehle.bv‐pfalz.de) .
An der Lehr‐ und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Hofgut Neumühle ist zum 01. Dezember 2014 eine Dissertation für eine Veterinärmedizinerin oder einen Veterinärmediziner in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen, Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie (Prof. Dr. Klaus Eder) zu vergeben.
Die Eckdaten
- Spannendes und hochaktuelles Thema zur Stoffwechselgesundheit (Leberstoffwechsel) bei der hochleistenden Milchkuh.
- Sie erheben selbstständig alle Daten im Milchviehstall der Lehr‐ und Versuchsanstalt für Viehhaltung, Hofgut Neumühle in 67728 Münchweiler an der Alsenz.
- Sie sammeln praktische Erfahrungen in der Milchproduktion am Hofgut Neumühle.
- Sie erhalten eine finanzierte Stelle über 3 Jahre (E 13/0,5).
- Sie arbeiten am Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie in einem international anerkannten wissenschaftlichen Team.
Unsere Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin
-Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift Spaß an der praktischen Milchviehproduktion
- Spaß am Umgang mit jungen Menschen
- Interesse an wissenschaftlichem Arbeiten in einem Team mit Doktorandinnen und Doktoranden
- Teamfähigkeit
- Überdurchschnittliche Motivation und Einsatzbereitschaft
- Kurzfristige Verfügbarkeit
- PKW‐Führerschein
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an folgende Adresse:
Dr. Christian Koch Lehr‐ und Versuchsanstalt für Viehhaltung,
Hofgut Neumühle Neumühle 1
67728 Münchweiler an der Alsenz
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Dr. Christian Koch zur Verfügung.
(Tel.: 06302/60343 oder e‐mail: c.koch@neumuehle.bv‐pfalz.de) .
12.10.14
Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei Rindern
Dosierungsvorschläge für
Arzneimittel bei Rindern und Schweinen von Ilka U. Emmerich, Thomas Wittek,
Isabella Hennig-Pauka
In der bewährten Reihe „Dosierungsvorschläge“ im für Nutztierpraktiker freundlichen
Format (Kitteltaschengröße,
abwaschbar) sind nun auch die Dosierungsvorschläge für Rind und Schwein erschienen.
Das Autorenteam besteht aus versierten
deutschen und österreichischen
Hochschuldozenten aus den jeweiligen Fachrichtungen. Die AutorInnen haben es
durch regen Gedankenaustausch mit ihren praktizierenden KollegInnen geschafft,
wirklich ein Buch für
den Praktiker zu schreiben. So ist gerade das Kapitel über den heiß diskutierten
Antibiotikaeinsatz sehr lesenswert. Wie geht man korrekt mit leider nicht sonderlich
aussagekräftigen
Resistenztests bei multifaktoriellen Infektionen um? Ist es sinnvoll,
antibiotische Reservemittel zu definieren und damit Praktiker zu zwingen, erst
Antibiotika zu nutzen, deren Anwendung zu einem hohen Prozentsatz nicht zu dem
gewünschten
Erfolg führt
und damit den Antibiotikaeinsatz zu erhöhen?
In den ersten sechs Kapiteln geben die
Autoren zu den Themen Arzneimittelrecht, Antibiotikaeinsatz orale Anwendung von
Arzneimitteln, Einsatz von Hormonen, Sedierung und Anästhesie
sowie Klauenbädern
beim Rind je eine allgemeine Übersicht.
Im Anschluss daran folgt dann das
Kernstück
des Buches - die Dosierungsvorschläge.
Alphabetisch geordnet nach Wirkstoffnamen können Sie sich hier sich über Indikation, Nebenwirkungen und
Besonderheiten, Kontraindikationen und Dosierungen informieren. Zudem gibt es
eine Auswahl von Handelspräparaten.
Besonders vorausschauend finde ich, dass auch Wirkstoffe aufgelistet sind, die
derzeit generell bei lebensmittelliefernden Tieren nicht angewendet werden dürfen, für die aber in der Literatur für Rind und Schwein Dosierungsvorschläge existieren und durchaus die Möglichkeit besteht, dass diese
Wirkstoffe in der Zukunft wieder auf den Markt gebracht und zugelassen werden könnten.
Es folgt das Kapitel zu Impfungen bei
Rindern und Schweinen. Die generellen Informationen stehen am Beginn, die nach
Infektionserkrankungen gelisteten Impfstoffe folgen.
In einem weiteren Abschnitt sind Präparatenamen gelistet und die
jeweiligen Wirkstoffe werden ihnen zugeordnet. Dies hilft dem Praktiker, der in
der Eile nur den Präparatenamen,
aber nicht den Wirkstoffnamen zur Hand hat, Präparate einzuordnen und die
voranstellende Tabelle zu nutzen.
In der letzten Auflistung werden die
Wirkstoffe den Indikationen zugeordnet.
„Zum
Nutzen des Nutztiers“
-
diesen Worten der Autoren möchte
ich mich gerne bei der Besprechung dieses neuen Memovets-Bandes anschließen. Denn ein richtig angewandter
Wirkstoff ist Grundlage für
eine erfolgreiche Therapie.
Interessant fand ich als Rinderpraktikerin
die Aspekte, die eher den bestandsbetreuenden
Schweinepraktiker betreffen, wie zum Beispiel die Bestandsimpfungen. Es
ist immer gut, über
seinen eigenen Tellerrand zu schauen und sich inspirieren zu lassen. Und auch
dies schafft dieser Memovet-Band, der hoffentlich bald in jedem Handschuhfach
eines Rinder- und Schweinepraktikers liegt.
Dosierungsvorschläge für
Arzneimittel bei Rindern und Schweinen von Ilka U. Emmerich, Thomas Wittek,
Isabella Hennig-Pauka, 1.Auflage 2014, Schattauer Verlag, 39,99 Euro
Tierärztin Kristin Resch, vet-consult
Tierärztin Kristin Resch, vet-consult
15.9.14
Abschlusssymposium: Studie zum chronischen Botulismus
TiHo-Wissenschaftler stellen Ergebnisse zum chronischen Krankheitsgeschehen in Milchviehbetrieben vor.
12. September 2014 Auf dem heutigen Abschlusssymposium stellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) die Ergebnisse ihrer Studie „Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischem Krankheitsgeschehen“ vor. „Wir konnten keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Clostridium botulinum und einem chronischen Krankheitsgeschehen auf Milchviehbetrieben oder bei einzelnen Tieren bestätigen. Das deutet daraufhin, dass C. botulinum nicht der wesentliche Hauptverursacher des chronischen Krankheitsgeschehen ist“, sagte Professorin Dr. Martina Hoedemaker, Leiterin der Klinik für Rinder der TiHo und hauptverantwortliche Wissenschaftlerin der Studie, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert wurde.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TiHo haben die Zusammenhänge zwischen chronischen Krankheitsfällen bei Milchkühen und C. botulinum untersucht. Sie ermittelten in 139 norddeutschen Milchviehbetrieben den C.-botulinum-Status, indem sie verdächtige und unverdächtige Herden auf das Vorkommen des Bakteriums und auf andere mögliche Krankheitsursachen untersuchten. In den Betrieben beurteilten sie die Körperkondition, das Gangbild, den hygienischen Zustand und den Zustand der Gelenke der Tiere. In den betroffenen Betrieben wählten sie fünf klinisch unauffällige und fünf chronisch kranke Tiere aus, die genauer untersucht und beprobt wurden. „Von jedem dieser insgesamt 1.389 Tiere haben die vier Studientierärzte Blut-, Pansensaft-, Kot-, Harn- und Haarproben entnommen. Wir haben den Kot und Pansensaft auf das Vorhandensein von Neurotoxin-Genvarianten von C. botulinum untersucht“, erklärte Svenja Fohler aus dem Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit der TiHo. Neben den Tierproben untersuchten sie Futtermittel- und Wasserproben. Die Wissenschaftler stuften anhand ihrer Untersuchungen knapp 18 Prozent der Betriebe und 6,19 Prozent der Tiere als Neurotoxin-Gen positiv ein. Lediglich in einer Kotprobe eines unauffälligen Tieres konnte ein Neurotoxin-Gen positives Isolat gefunden werden. Die klinische Untersuchung der Tiere ergab, dass das häufigste Symptom chronisch kranker Tiere eine Lahmheit aufgrund von einer Klauenerkrankung war - unabhängig vom Auftreten von C. botulinum.
Des Weiteren wurden die Betriebe auf 74 mögliche Clostridien-Risikofaktoren wie beispielsweise das Vorkommen von Tauben oder die Verfütterung von Biertreber untersucht. „Wir konnten lediglich bei 13,5 Prozent der diskutierten Risikofaktoren einen Zusammenhang nachweisen. Mögliche Risikofaktoren für ein chronisches Krankheitsgeschehen sind nach diesen Ergebnissen beispielsweise die Weidehaltung laktierender Kühe in Zusammenhang mit der Weidengröße sowie verfrühtes Öffnen oder ein fehlender Verschluss des Maissilos“, sagte Hoedemaker. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Betriebe, in denen vermehrt chronische Erkrankungen auftraten, zum Teil erhebliche Probleme mit der allgemeinen Tiergesundheit hatten. „Als mögliche Ursache für die chronischen Herdengesundheitsprobleme konnten wir Faktoren in der Fütterung, in der Hygiene sowie im Kuhkomfort identifizieren. So waren die Kühe auf betroffenen Betrieben häufiger zu dünn, lahm und verschmutzt“, sagte Katharina Charlotte Jensen aus dem Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung der TiHo. Viele der betroffenen Milchviehbetriebe wiesen ebenfalls Mängel in der Energiedichte des Futters, der Grobfutterqualität und der Art und Beschaffenheit der Liegeboxen auf. „Hier zeigen sich Möglichkeiten, um das chronische Krankheitsgeschehen in den Griff zu bekommen“, so Jensen.
Chronischer Botulismus? Die unspezifische Erkrankung mit chronischem Verlauf trat in den vergangenen Jahren in Milchviehbetrieben vermehrt auf. Hierbei kam es zu einem schleichenden Verfall der betroffenen Tiere. Zu den Symptomen zählten eine herabgesetzte Milchproduktion, Euterentzündungen, Lahmheiten sowie Lähmungen bis hin zum Festliegen. Als mögliche Ursache wurden die Neurotoxine von C. botulinum als Auslöser des sogenannten viszeralen beziehungsweise chronischen Botulismus intensiv diskutiert. Die Verfechter dieser These vermuten, dass C. botulinum die Darmwand besiedelt und über einen längeren Zeitraum geringe Mengen des Toxins im Körper ausgeschüttet werden. Das würde den schleichenden Leistungsabfall und die unspezifischen Krankheitssymptome der Milchkühe erklären.
Das Bakterium C. botulinum bildet Toxine, die zu den stärksten Nervengiften zählen. Das durch die Toxine hervorgerufene Krankheitsbild des klassischen Botulismus ist bei Menschen und Tieren seit langem bekannt. Die typischen Symptome - schwankender Gang bis hin zum Festliegen, Schwanz- und Zungenlähmung - werden durch Muskellähmungen hervorgerufen. Im Gegensatz dazu ist der postulierte „viszerale Botulismus“ aufgrund eines fehlenden wissenschaftlichen Nachweises bisher als Krankheitsbild nicht anerkannt.
Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Professorin Dr. Martina Hoedemaker,
PhD Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover Klinik für Rinder
Tel.: +49 511 856-7246
martina.hoedemaker@tiho-hannover.de
(Pressemitteilung der TiHo Hannover)
12. September 2014 Auf dem heutigen Abschlusssymposium stellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) die Ergebnisse ihrer Studie „Bedeutung von Clostridium botulinum bei chronischem Krankheitsgeschehen“ vor. „Wir konnten keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Clostridium botulinum und einem chronischen Krankheitsgeschehen auf Milchviehbetrieben oder bei einzelnen Tieren bestätigen. Das deutet daraufhin, dass C. botulinum nicht der wesentliche Hauptverursacher des chronischen Krankheitsgeschehen ist“, sagte Professorin Dr. Martina Hoedemaker, Leiterin der Klinik für Rinder der TiHo und hauptverantwortliche Wissenschaftlerin der Studie, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert wurde.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TiHo haben die Zusammenhänge zwischen chronischen Krankheitsfällen bei Milchkühen und C. botulinum untersucht. Sie ermittelten in 139 norddeutschen Milchviehbetrieben den C.-botulinum-Status, indem sie verdächtige und unverdächtige Herden auf das Vorkommen des Bakteriums und auf andere mögliche Krankheitsursachen untersuchten. In den Betrieben beurteilten sie die Körperkondition, das Gangbild, den hygienischen Zustand und den Zustand der Gelenke der Tiere. In den betroffenen Betrieben wählten sie fünf klinisch unauffällige und fünf chronisch kranke Tiere aus, die genauer untersucht und beprobt wurden. „Von jedem dieser insgesamt 1.389 Tiere haben die vier Studientierärzte Blut-, Pansensaft-, Kot-, Harn- und Haarproben entnommen. Wir haben den Kot und Pansensaft auf das Vorhandensein von Neurotoxin-Genvarianten von C. botulinum untersucht“, erklärte Svenja Fohler aus dem Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit der TiHo. Neben den Tierproben untersuchten sie Futtermittel- und Wasserproben. Die Wissenschaftler stuften anhand ihrer Untersuchungen knapp 18 Prozent der Betriebe und 6,19 Prozent der Tiere als Neurotoxin-Gen positiv ein. Lediglich in einer Kotprobe eines unauffälligen Tieres konnte ein Neurotoxin-Gen positives Isolat gefunden werden. Die klinische Untersuchung der Tiere ergab, dass das häufigste Symptom chronisch kranker Tiere eine Lahmheit aufgrund von einer Klauenerkrankung war - unabhängig vom Auftreten von C. botulinum.
Des Weiteren wurden die Betriebe auf 74 mögliche Clostridien-Risikofaktoren wie beispielsweise das Vorkommen von Tauben oder die Verfütterung von Biertreber untersucht. „Wir konnten lediglich bei 13,5 Prozent der diskutierten Risikofaktoren einen Zusammenhang nachweisen. Mögliche Risikofaktoren für ein chronisches Krankheitsgeschehen sind nach diesen Ergebnissen beispielsweise die Weidehaltung laktierender Kühe in Zusammenhang mit der Weidengröße sowie verfrühtes Öffnen oder ein fehlender Verschluss des Maissilos“, sagte Hoedemaker. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Betriebe, in denen vermehrt chronische Erkrankungen auftraten, zum Teil erhebliche Probleme mit der allgemeinen Tiergesundheit hatten. „Als mögliche Ursache für die chronischen Herdengesundheitsprobleme konnten wir Faktoren in der Fütterung, in der Hygiene sowie im Kuhkomfort identifizieren. So waren die Kühe auf betroffenen Betrieben häufiger zu dünn, lahm und verschmutzt“, sagte Katharina Charlotte Jensen aus dem Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung der TiHo. Viele der betroffenen Milchviehbetriebe wiesen ebenfalls Mängel in der Energiedichte des Futters, der Grobfutterqualität und der Art und Beschaffenheit der Liegeboxen auf. „Hier zeigen sich Möglichkeiten, um das chronische Krankheitsgeschehen in den Griff zu bekommen“, so Jensen.
Chronischer Botulismus? Die unspezifische Erkrankung mit chronischem Verlauf trat in den vergangenen Jahren in Milchviehbetrieben vermehrt auf. Hierbei kam es zu einem schleichenden Verfall der betroffenen Tiere. Zu den Symptomen zählten eine herabgesetzte Milchproduktion, Euterentzündungen, Lahmheiten sowie Lähmungen bis hin zum Festliegen. Als mögliche Ursache wurden die Neurotoxine von C. botulinum als Auslöser des sogenannten viszeralen beziehungsweise chronischen Botulismus intensiv diskutiert. Die Verfechter dieser These vermuten, dass C. botulinum die Darmwand besiedelt und über einen längeren Zeitraum geringe Mengen des Toxins im Körper ausgeschüttet werden. Das würde den schleichenden Leistungsabfall und die unspezifischen Krankheitssymptome der Milchkühe erklären.
Das Bakterium C. botulinum bildet Toxine, die zu den stärksten Nervengiften zählen. Das durch die Toxine hervorgerufene Krankheitsbild des klassischen Botulismus ist bei Menschen und Tieren seit langem bekannt. Die typischen Symptome - schwankender Gang bis hin zum Festliegen, Schwanz- und Zungenlähmung - werden durch Muskellähmungen hervorgerufen. Im Gegensatz dazu ist der postulierte „viszerale Botulismus“ aufgrund eines fehlenden wissenschaftlichen Nachweises bisher als Krankheitsbild nicht anerkannt.
Für fachliche Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Professorin Dr. Martina Hoedemaker,
PhD Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover Klinik für Rinder
Tel.: +49 511 856-7246
martina.hoedemaker@tiho-hannover.de
(Pressemitteilung der TiHo Hannover)
10.9.14
Kostenfreies Seminar für Studierende
Rindermedizin ist
weiblich
Termin: Do, 2.10. , 15-16.30 Uhr
Ort: Fachbereich
Veterinärmedizin, Königsweg 65, 14613 B
Zielgruppe: Alle, v.a.
Studierende, Junge Tierärztinnen
Programm
Begrüßung
Prof. Dr. K. Müller Initiative Rin.da: Zahlen, Ziele, erste Ergebnisse
Prof. Dr. K. Müller Initiative Rin.da: Zahlen, Ziele, erste Ergebnisse
Kurzvorträge
Dr. Christiane Zaspel
Dr. Birgit Reski-Weide Vereinbarkeit von Beruf u. Familie in der tierärztlichen Praxis
Dr. Birgit Reski-Weide Vereinbarkeit von Beruf u. Familie in der tierärztlichen Praxis
Dr. P.
Bergmann Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Industrie
Dr. M. Tischer Selbständig?
Eine Alternative
TÄ Lisa Leiner Vetstage und Mentorinnen-Programm
Studierende
A.L. Worpenberg Erfahrungen mit dem ersten Mentorinnen-Mentee-Tandem
A.L. Worpenberg Erfahrungen mit dem ersten Mentorinnen-Mentee-Tandem
Bitte
melden Sie sich zum kostenfreien Seminar Nr. 5
an!
31.8.14
Attraktives Jobangebot für Doktoranden und Anfänger
Tierarzt/-in als Krankheitsvertretung
kurzfristig gesucht ab sofort
Stellenbeschreibung:
Die Tierarztpraxis liegt im Landkreis Cuxhaven. Der Schwerpunkt der
Tätigkeit liegt im Kleintierbereich. Eine kleine aber feine Rinderpraxis
gehört ebenfalls zur Praxis (Ultraschall, endoskop. OP der LLMV und der
RLMV).
Die Stelle ist ausdrücklich für Doktoranden bzw. Anfänger geeignet.
Eine Mitarbeit im Rinderbereich ist freiwillig.
Arbeitszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 bis 13:00 und 15:30 bis 19:30 Uhr
Vergütung: 1.000 Euro, brutto pro Woche
(Überstunden werden extra vergütet)
Unterkunft kann in der Praxis gestellt werden.
Tierarztpraxis Dorum
Dr. Ingo Alpers
Speckenstr.10
27632 Dorum
Tel.: 04742-926301
Fax.: 04742-926302
info@tierarzt-dorum.de
kurzfristig gesucht ab sofort
Stellenbeschreibung:
Die Tierarztpraxis liegt im Landkreis Cuxhaven. Der Schwerpunkt der
Tätigkeit liegt im Kleintierbereich. Eine kleine aber feine Rinderpraxis
gehört ebenfalls zur Praxis (Ultraschall, endoskop. OP der LLMV und der
RLMV).
Die Stelle ist ausdrücklich für Doktoranden bzw. Anfänger geeignet.
Eine Mitarbeit im Rinderbereich ist freiwillig.
Arbeitszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 bis 13:00 und 15:30 bis 19:30 Uhr
Vergütung: 1.000 Euro, brutto pro Woche
(Überstunden werden extra vergütet)
Unterkunft kann in der Praxis gestellt werden.
Tierarztpraxis Dorum
Dr. Ingo Alpers
Speckenstr.10
27632 Dorum
Tel.: 04742-926301
Fax.: 04742-926302
info@tierarzt-dorum.de
27.8.14
Mentorin für die Berufsplanung finden
Die Initiative Rin.da (bedeutet so viel wie "Rein da" in die Rindermedizin) hat sich zum Ziel gesetzt, Studierenden bei der Karriereplanung in allen Bereichen der Rindermedizin (Praxis, Universität, Industrie, Amt,..) zu unterstützen und Zukunftsvisionen für familienfreundlichere Arbeitsmodelle zu fördern.
 |
| Mentees profitieren von den Erfahrungen der Mentorin |
Die Mentorin verfügt dabei über Kenntnisse, die dem Mentee bei seinen nächsten Entwicklungsschritten helfen sollen. In den Gesprächen geht es dann um Praktikumsplätze, die richtige Doktorarbeit, Kinderbetreuung oder Fragen zu Bewerbungen.
Die Mentees profitieren vom Netzwerk der Mentorinnen und erweitern dies durch ihre eigene Mitarbeit.
Dieses Programm wird nun umgesetzt und ist offen für Bewerber/innen. Bewerbungen sollten dabei bitte folgende Fragen beantworten:
» Warum möchte ich Mentee werden?
» Was verbindet mich mit der Nutztiermedizin?
» Bin ich ortsgebunden?
» Wo und in welchem Nutztierbereich möchte ich ggf. später praktizieren?
» Was verbindet mich mit der Nutztiermedizin?
» Bin ich ortsgebunden?
» Wo und in welchem Nutztierbereich möchte ich ggf. später praktizieren?
Des Weiteren benötigen wir einen Lebenslauf und ggf. Empfehlungsschreiben früherer Praktika, sofern vorhanden. Bewerbung
Programmablauf:
Bewerbungsschluss: 19.9.2014
Persönliche Kontaktaufnahme im Anschluss möglich zwischen Mentee und Mentor. Ggf. erste Treffen und erstes Stecken von gemeinsamen Zielen.
Offizielle Begrüßung der Tandems beim Berlin-Brandenburgischen Rindertag 2014
-
Kostenfreies Seminar: Rindermedizin ist weiblich
Termin: Do, 2.10. , 15-18 Uhr
Ort: Fachbereich Veterinärmedizin, Königsweg 65, 14613 Berlin
Anmeldung erwünscht (Seminar 5 - kostenfrei)
Das Seminar ist weiter offen für alle Interessierten.
Das Programm läuft 2 Jahre mit gesetzten Zielen und der Verpflichtung, sich einmal pro Jahr persönlich zu treffen. Das Programm endet nach 2 Jahren mit einer kleinen Feier für die erreichten gemeinsamen Ziele. Natürlich kann der Kontakt im Anschluss freiwillig weiter bestehen.
Infos und Bewerbung:
https://www.vetstage.de/mentoring/
25.8.14
Familienfreundliche Teilzeitstelle im Süden von Berlin
Der Landkreis Teltow-Fläming schreibt extern die Stelle
Tierarzt Veterinärwesen (m/w), Teilzeit: 20 Wochenarbeitsstunden
zur sofortigen Besetzung aus. Die Behörde hat ihren Sitz am Standort Luckenwalde.
Die Tätigkeit ist mit Außendienst verbunden.
Tierarzt Veterinärwesen (m/w), Teilzeit: 20 Wochenarbeitsstunden
zur sofortigen Besetzung aus. Die Behörde hat ihren Sitz am Standort Luckenwalde.
Die Tätigkeit ist mit Außendienst verbunden.
Arbeitsaufgaben
- Tierschutzkontrollen einschließlich Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung von Verstößen gegen das Tierschutzrecht
- .......
22.8.14
RindertierärztIN in Schleswig-Holstein gesucht!
Die Rinderpraxis iQVet sucht ab sofort
eine(n) neue(n) Kollegen/in. Geboten wird eine
Vollzeit-Rinderstelle
in Schleswig Holstein. Wir decken alle Bereiche der kurativen
Praxis
und Bestandsbetreuung ab.
Um sich ein erstes Bild von uns zu machen, besuchen Sie gerne unsere Homepage : www.iqvet.de
Ein regelmäßiger interner Wissenstransfer, bezahlte Fortbildung, geregelte Dienste sind für uns ebenso selbstverständlich, wie eine gute Einarbeitung. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: fuchs@iqvet.de
Um sich ein erstes Bild von uns zu machen, besuchen Sie gerne unsere Homepage : www.iqvet.de
Ein regelmäßiger interner Wissenstransfer, bezahlte Fortbildung, geregelte Dienste sind für uns ebenso selbstverständlich, wie eine gute Einarbeitung. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: fuchs@iqvet.de
21.8.14
GroßtierärztIN gesucht
Landpraxis im Hunsrück sucht Tierarzt/-ärztin
für Rinder- und Pferdepraxis in Voll- oder Teilzeit.
Tel. 06763-3322
lwehner@online.de
30.6.14
Familienfreundliche Stelle für LandwirtschaftsmeisterIN o.ä. in der Ostschweiz
17.5.14
Lesetipp: Arzneimittelrecht für Nutztierhalter
Arzneimittelrecht
für Nutztierhalter, herausgegeben vom aid infodienst, 3.
Auflage, Stand März 2014
 Am 1. April
2014 ist die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) in Kraft getreten.
Diese Novelle enthält Änderungen im
Bereich der Tierarzneimittelanwendung. Ziel der Novelle ist es, den Einsatz von
Antibiotika in der Nutztierhaltung deutlich zu reduzieren. Die Novelle war der
Anlass, die Broschüre „Arzneimittelrecht für
Nutztierhalter“ neu aufzulegen und Veränderungen, die sich
aus ihr ergeben, zu erläutern.
Am 1. April
2014 ist die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) in Kraft getreten.
Diese Novelle enthält Änderungen im
Bereich der Tierarzneimittelanwendung. Ziel der Novelle ist es, den Einsatz von
Antibiotika in der Nutztierhaltung deutlich zu reduzieren. Die Novelle war der
Anlass, die Broschüre „Arzneimittelrecht für
Nutztierhalter“ neu aufzulegen und Veränderungen, die sich
aus ihr ergeben, zu erläutern.
Diese Broschüre,
die der bekannte aid infodienst herausgibt, richtet sich an Tierhalter und an
Tierärzte, um das Arzneimittelrecht für beide Gruppen
verständlicher zu machen. Auf 57 Seiten, gegliedert in 22 Kapiteln
versucht die Broschüre das Arzneimittelrecht für
den Anwender aufzubereiten. So wird zum Beispiel in einem Kapitel ganz klar
definiert, für wen das AMG überhaupt gilt, in dem nächsten
Kapitel wird verdeutlicht, was Arzneimittel sind. Die nächsten Kapitel
widmen sich den neuen Regelungen zur Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes.
Redaktionsschluss war allerdings März 2014. Bis heute (Mai 2014) sind
jedoch einige Regelungen noch ungeklärt. Erst zu Beginn der ersten
Aufzeichnungspflicht ab 1. Juli 2014 soll die Frage derab welcher
Bestandsuntergrenze für die einzelnen Nutztiergruppen die
Dokumentationspflicht greift, zwischen Bund und Ländern geklärt
sein. aid bietet den Service an, auf seiner Homepage den aktuellen Stand
nachzuliefern.
Im dritten
Abschnitt wird auf die Dokumentation, tierärztliche
Hausapotheke, Lagerung und Anwendung von Arzneimittel eingegangen. Hier gefällt
mir besonders gut, dass die Autoren die Fragen des wirklichen Leben angehen:
Was kann und darf der Landwirt mit den Resten eines verschreibungspflichtigen
Arzneimittels machen? (Antwort: Aufbewahrung ist zulässig, es ist in dem
Sinne nicht die verbotene Bevorratung. Eine Anwendung an einem anderen Tier ist
dann zulässig, wenn die Tierärztin/der Tierarzt das Arzneimittel
nach der Untersuchung für das Tier verschreibt.)
Im vierten
Abschnitt greifen die Autoren spezielle Arzneimittel wie zum Beispiel Homöopathika
oder Phytotherapeutika auf und spezifieren deren Anwendungsregeln.
Für
uns Rinderpraktiker finde ich das Kapitel zu den Klauenbädern, das ganz klar
sagt, was unter welchen Umständen erlaubt ist, besonders gut. Diese
Übersicht hat mir sehr geholfen die rechtliche Stellung der
Anwendung von Klauenbädern zu verstehen, nachdem sie so
lange Zeit diskutiert wurde.
Ich kann
diese Broschüre empfehlen, denn sie erklärt gut strukturiert
mit vielen lebensnahen Beispielen das teilweise trockene und verwirrende
Arzneimittelrecht. Die Autorengruppe hat auch die neuen Entwicklungen im
Arzneimittelvertrieb aufgegriffen wie zum Beispiel den Internetversand von
verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln.
Durch den frühen
Erscheinungstermin hat der Leser eine Broschüre in der Hand, die
ein ganz aktuelles Thema aufgreift und gezwungenermaßen Fragen offen
lassen muss. Dies versucht der Verlag mit seiner Internetseite auszugleichen.
Ein späterer Erscheinungstermin hätte andererseits
den Vorteil gehabt, dass die Landwirte und Tierärzte bereits erste
Erfahrungen mit der Umwertung der Regelungen gehabt hätten. Außerdem
wären weiter Fragen schon geklärt worden.
Mir gefällt
es gut, dass ich nach so vielen Artikeln, Meldungen und Seminaren zum neuen
Arzneimittelrecht schon so schnell eine so umfassende und gutverständliche
Broschüre in den Händen halten kann. Meiner Ansicht gehört
sie in jede Praxis und kann dort auch von allen Angestellten einmal
durchgelesen werden.
Arzneimittelrecht
für Nutztierhalter, herausgegeben vom aid infodienst, 3.
Auflage, ISBN 978-3-8308-1081-0, Bestell-Nr. 1575, Preis: 3,00 €,
Stand März 2014
Rezension: Tierärztin Kristin Resch
8.4.14
8.Mai Mastitistag in Kassel
Einladung zum Praktischen Tierarzt Kongress
Erstmalig bietet Der Praktische Tierarzt
Kongress in Kassel (ehemals Frankfurter Tierärztekongress) Vorträge zur
Nutztiermedizin an.
Die Vorträge „Rind“ und „Schwein“ finden am Donnerstag, den 8. Mai 2014 von 10 bis 18 Uhr statt.
In Kombination mit einer Tages- oder Kongresskarte Kleintier und Pferd sparen Sie 90 €.
Ihre Online-Anmeldung nehmen Sie hier vor:
Wir freuen uns auf Sie!
Schlütersche
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Wir freuen uns auf Sie!
Schlütersche
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
1.4.14
Buchrezension: Klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin
 Die Zeiten, in denen die Rinderpraktikerin schon froh war,
wenn ihre Patienten in Labordiagnostik- Büchern überhaupt erwähnt wurden, sind
definitiv vorbei.
Die Zeiten, in denen die Rinderpraktikerin schon froh war,
wenn ihre Patienten in Labordiagnostik- Büchern überhaupt erwähnt wurden, sind
definitiv vorbei.
Der neue „ Kraft- Dürr“ (7.Auflage) behandelt die Rinder ausführlich,
nicht nur innerhalb der allgemeinen Abschnitte, sondern auch in einem
umfangreichen Kapitel „Spezielle Untersuchungen und Labordiagnostik beim
Wiederkäuer“, in dem besonders intensiv Methoden und strategisches Vorgehen in
der Herdendiagnostik behandelt werden. Hier, wie in allen Kapiteln, werden die
komplexen Zusammenhänge durch übersichtliche Tabellen und Flussdiagramme
anschaulich dargestellt.
Wieder gibt es ein Kapitel „Wirtschaftlichkeit und
Kostenerfassung im Praxislabor“, das gerade auch für die Nutztierpraxis
wertvolle Entscheidungshilfen zu Aufbau und Erweiterung des Praxislabors an die
Hand gibt.
In den Kapiteln, die die einzelnen Organsysteme beschreiben,
wird viel auf tierartliche Besonderheiten eingegangen, und es werden auch neue
bzw. seltener angewandte Untersuchungen dargestellt, wie z.B. die Zytobrush-
Methode oder die Haaranalyse zur Feststellung von Spurenelementversorgung bzw.
– intoxikation.
Besonders informativ für die Nutztierpraktikerin sind auch
die Kapitel über Untersuchungen am männlichen und weiblichen Genitaltrakt bei
Großtieren.
Die parasitologische Diagnostik wurde früher gern mit
Verweis auf spezielle Parasitologie- Lehrbücher ausgeklammert, auch das ist
hier ganz anders: Im ausführlichen Parasitologie- Teil sind nicht nur alle
relevanten Nachweisverfahren ausführlich beschrieben, auch die Fotos
einschlägiger Parasiten machen ein Parasitologie- Buch zwar nicht ganz
überflüssig, geben aber zumindest anschauliche Beispiele für die wichtigsten
Parasiten der Wiederkäuer.
Dieser Teil behandelt auch kleine Wiederkäuer und Schweine
sehr umfangreich, wohingegen der tierartspezifische Teil zum Schwein extrem
knapp gehalten ist und sich auf die Untersuchung der Galle auf Mykotoxine,
Bronchoalveolarlavage und Lungenbiopsie beschränkt. Wer auch Schweine
behandelt, wird hier nach dem umfangreich Rinderkapitel etwas enttäuscht sein.
Sehr hilfreich ist allerdings die Tabelle mit den Referenzwerten für Minipigs
am Ende des Kapitels. Die Gesamtübersichten für „normale Hausschweine“
können aus dem Internet heruntergeladen
werden, ebenso wie die für die anderen „gängigen Haustierarten“. Hier sofort ein
Format zur Hand zu haben, das ausgedruckt
und für einen raschen Überblick im Labor aufgehängt werden kann, ist ein
toller Service, auch wenn man beim ersten Durchblättern des Buches die großen
Tabellen vermisst.
Dieser „Kraft- Dürr“ ist eine absolut lohnende Anschaffung
für jeden angehenden und fertigen Tierarzt. Das kompetente Autorenteam gibt
nicht nur Studenten, sondern auch „alten Hasen“ die Gelegenheit, noch etwas
Neues zu erfahren.
Blick in das Buch
Blick in das Buch
Andreas
Moritz (Hrsg.): Klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin
Schattauer,
Stuttgart 2014, 7. Auflage, 934 Seiten, Preis 119,99, ISBN 978-3-7945-2737-3
Rezension: Tierärztin Esther von Lom, vet-consult
10.3.14
Buchrezension: Parasitendiagnostik
Ronald Schmäschke
Die koproskopische Diagnostik von Endoparasiten in der Veterinärmedizin
Schlütersche, Hannover 2013 (1. Auflage), ISBN: 978-3-89993-676-6, Preis: 44,95 €.
Die koproskopische Diagnostik von Endoparasiten in der Veterinärmedizin
Schlütersche, Hannover 2013 (1. Auflage), ISBN: 978-3-89993-676-6, Preis: 44,95 €.
Dieses neue Parasitenbuch bietet umfassende Hilfestellung
für alle, die mittels Kotuntersuchung Endoparasiten bei Tieren diagnostizieren.
Die richtige Identifikation der Parasiten, ihrer Eier und ihrer
unterschiedlichen Entwicklungsstadien gelingt aber nur, wenn einem die
Morphologie vertraut ist. Und dies schafft dieses Buch – zum einen durch seine
sehr guten, leichtverständlichen Texte, zum anderen durch die hervorragenden
Abbildungen. Und nur eine gesicherte Diagnose kann die Grundlage sein für die
richtige Therapie.
Es ist aber auch für die Praktiker geeignet, die sich mehr
Hintergrundwissen aneignen möchten, damit sie parasitologische Befunde und die
damit verbundene Problematik besser verstehen können. Denn zum Beispiel ein
Nachweis von Eimerien beim Schaf bedeutet noch lange nicht, dass die
Durchfallursache Eimerien sind. Wie zuverlässig aber ist die Differenzierung
der 15 verschiedenen Eimerienarten beim Schaf, wovon nur zwei als pathogen
eingestuft sind.
Von der Probenentnahme über Versand, Befundbogen,
diagnostischen Methoden und den tatsächlich nachgewiesenen Parasitenstadien,
holt dieses Buch den Leser in jedem Stadium der Diagnostik ab.
Das Spektrum der Tierarten ist groß – dargestellt sind die
Endoparasiten der Wiederkäuer, Pferd, Schwein, Hund und Katze, Geflügel,
Kaninchen, Meerschweinchen, Maus, Ratte, Hamster und Igel. Das Gute ist, dass
jede Tierart gleich aufgemacht ist und so interessant dargestellt ist, dass man
in diesem Buch auch gerne stöbert – so liest die Großtierpraktikerin denn auch
mal wieder etwas über Endoparasiten bei Kaninchen!
Tatsächlich ist dieses Buch aber ein diagnostischer
Atlas, der aufzeigt, wie man die Parasiten nachweisen kann, wie man sie im
Mikroskop differenzieren kann, ev. welche Besonderheiten mit ihnen einhergehen
und wie häufig sie auftreten. Besonders praktisch und lebensnah finde ich die
Hinweise der Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Endoparasiten und das
Extrakapitel über Pseudoparasiten, die zu Verwechslungen und falschen Diagnosen
führen können.
Wer mehr über das
parasitäre Krankheitsbild wissen möchte und die Therapie, der muss zu einem
veterinärmedizinischen Parasitologiebuch greifen. Eine Kombination von diesem Buch und einem
allgemeinen Parasitologiebuch führt einen interessierten Praktiker zu einem
umfassenden Bild über Endoparasiten und ihre Diagnostik – und das auf eine gut
verständliche und anschauliche Art und Weise!
Fazit: Ich kann dieses Buch aus den oben genannten Gründen
unbedingt empfehlen – auch der faire Preis macht es einem leicht, dieses Buch
in seine Bibliothek aufzunehmen. Endlich hat auch die praktizierende
Tierärztin ein Bild von dem Erreger vor
Augen, wenn man den Befund liest. Oder – noch besser – dieses Buch hilft einem,
das Auge in seinem eigenen Praxislabor zu schulen und zu eigenen gesicherten
Befunden zu kommen.
26.2.14
Beschäftigungsverbot für werdende und stillende Mütter
 |
| Autorin: Großtierärztin Dr. Inke Siewers, i.siewers@web.de |
Abonnieren
Kommentare (Atom)